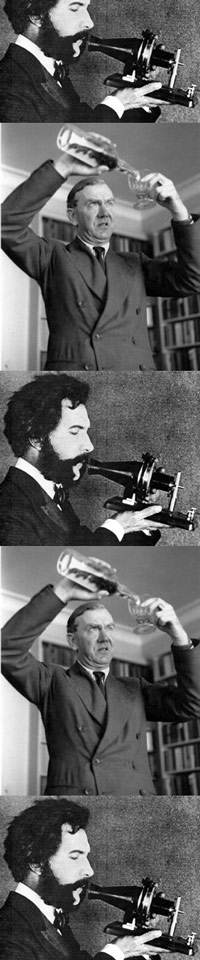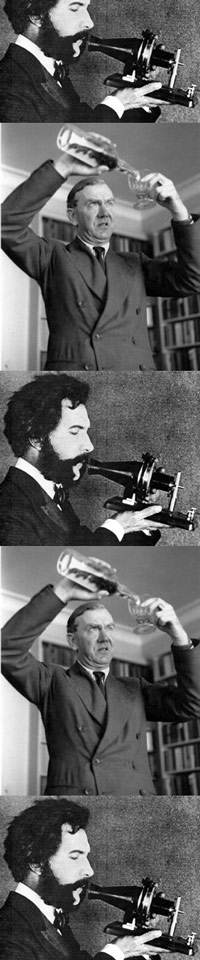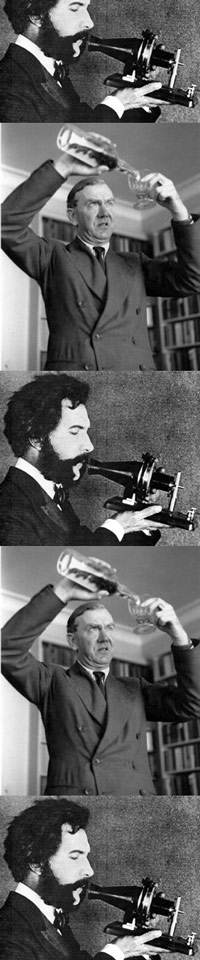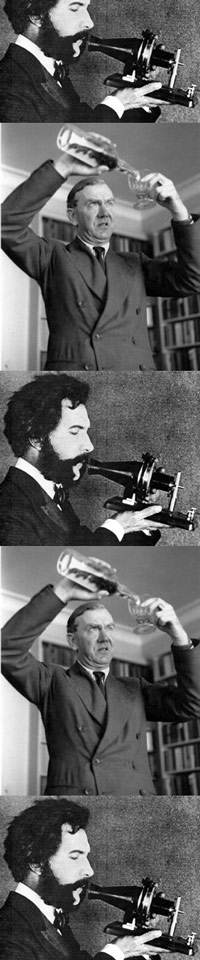.
Andrea Lehmanns Greeneland
Andrea Lehman hat eine neue wundergespickte malerische Raumskulptur erdacht, gemalt und gebaut. Auftritt: die Euphonia, ein Instrument zur Erzeugung von menschlichen Stimmlauten, Vorläufer der Erfindung des Telefons, die Alex. Graham Bell dann für sich beanspruchen und patentieren sollte, motiviert durch Gier und ein ererbtes philantropisches Interesse an Taubstummen und ihrer eugenischen Verhinderung für alle Zeiten.
Wir betreten Greeneland, eine besondere Parallelwelt, in deren Details und weitem historischem Hintergrund die Technologien des späten 19. Jahrhunderts und die Sorgen und Permutationen des späten britischen Empires der ersten Hälfte des letzten, 20sten als Licht-Mahre und Albdrücke hindurchscheinen.
Hintergründiger, schwarzer; intelligent verspielter Humor blitzt auf, so als würden mit prätechnologischen Gadgets versehene Goldfische, oder waren es Katzenhaie? – in der Kristallkugel eines eleganten siebenbürgischen Hellsehers Geheimdienstmantras aufsagen. Dann tauchen wir ein in ein Spiegelspiel, daß Lehmann mit sich selbst, uns, den Betrachtern, aber vor allem mit den malerischen Mitteln, dem skulpturalen Umraum und nicht zuletzt mit dem kunst- und zeitgeschichtlichen Fundus in ausgebuffter Sophistikation in Gang setzt. Was Frau Lehmann (*1968) dazu bewog, die beiden Grahams, Greene und Bell, Tauben und Taube, als phantastische Protozoen in ihr eigenes, ganz spezielles Goldfischglas auszusetzen, erahnen wir wohl, vielleicht aber
auch nur vage-virtual.
Wo liegt Greeneland?
Greeneland ist nicht nur ein dunkles, grünlich schimmerndes Gröhnland, sondern auch Graham Greene’s Land, durchzogen von den Erfindungen und finsteren Plänen eines Alexander Graham Bell, dem eugenischen Propagator und Hersteller des ersten marktreifen Telefons, ein Urahn der Telekommunikation.
Ein dunkles Territorium im Nirgendwo der Imagination als auch der Gelehrtenrepublik, liegt Greeneland nahe bei Le-Carrè-Land und Joseph Conrad Country. In Frau Lehmanns Welt liegt es allerdings noch weiter oben, in einem hellsichtigen Jenseits der Vernunft. Im Kern ihres Werk sehen wir eine überbordende, doch disziplinierte Imagination und wahren Witz mit malerischer Brillanz gekoppelt am Werk. Ohne die Tuchfühlung mit der Physis und ihrer Schönheit aus den Augen und Händen zu geben oder die Füße vom Boden der Tatsachen zu nehmen, zeigt uns Frau Lehmann die Pfade durch ihr zugleich vertracktes und weitherziges Universum - durch dessen Treppenhaus, neben Bosheit markierenden Stimmen, ein verwehtes Gelächter zieht, dem geneigte Ohren beim Lesen von Cervantes' und Swifts Werken begegneten.
Background Thoughts in the Back Room
Graham Greene (*1904) soll sich in seiner Jugend mit Russischem Roulette vergnügt haben und die Psychiatrie von innen kennengelernt haben; kurz, ein vielleicht etwas verwilderter Lehrersohn. Mit 22 konvertierte er zum Katholizismus und heiratete eine Katholikin. Ausgebildet in Oxford, arbeitete Greene als Journalist und begann ab 1923, seine Erzählungen und Romane zu veröffentlichen. Im 2. Weltkrieg und bis Anfang der 60er arbeitete er für den britischen Geheimdienst MI6. Mit seinem Roman „Die Kraft und die Herrlichkeit“ schaffte es Greene in den Index, den vatikanischen Giftschrank verbotener Bücher, wenn auch Pabst Montini ihm beruhigend beschied: "Mr. Greene, some aspects of your books are certain to offend some Catholics, but you should pay no attention to that." Viele, fast würde man meinen alle, seiner Bücher wurden Bestseller und dienten als Vorlagen für einige Meisterwerke des Kinos. „Der dritte Mann“ mit Orson Welles hat, als Film wie als Begriff über die Jahrzehnte quasi mythischen Status angenommen. Reisen, Schreiben und Gin Tonic waren seine Lebenselixiere. Die unverwechselbare Melange aus Melancholie, verquerem bis philosophischem, ethisch-religiösem Denken und Fühlen, eine quasipathologische Schuldbesessenheit - nicht nur katholischer Machart – ebenso wie die Verstrickung in tatsächliche Schuld und echten Verrat – dazu die genaue und dichte atmosphärische Schilderung der Protagonisten; von Diplomaten, Agenten, Gangstern, Geistlichen und den zugehörigen Frauen – zum anderen ihrer Umgebung: der Kolonialwelt des britischen Raj in der unaufhaltsam beginnenden Auflösung; und des alten Europas - politische Komplikationen im kolonialen Milieu der Sechziger Jahre und das Ende des Empires, nebst Übergabe an die Kolonialländer beziehungsweise den noch jungen Weltmachtaspiranten USA - all das macht Greenes Bücher, neben denen Le Carrés und anderer, zu einer literarischen, fast „authentischen“ Quelle zur Lage des „Western Mind“ im 20. Jahrhundert und zugleich zu einem süchtig-machenden Lesevergnügen.
Una Sancta Ecclesia
Das Konvertieren zum katholischen Christentum war eine intellektuelle Mode nach dem Ende des 1. Weltkriegs aus diversen Motiven: während die Dadabären in Zürich sehr zivil tobten, Tristan Tzara in der kommunistisch-surrealistischen "Bewegung" als Propagandist und Organisator sich gerierte und München zur anarchistischen Stadtrepublik mutierte, war der Eintritt in die Heilig-Römische eine der möglichen „konservativen“, anti-modernen Reaktionen auf das definitive Ende aller Gewißheiten.
Die Reihe der Schriftsteller, die entweder konvertierten oder in den Schoß der Kirche zurückkehrten, ist lang. J.K. Huysmans, G. K. Chesterton, Julien Green, Evelyn Waugh, François Mauriac, Edith Sitwell, Anthony Burgess (A Clockwork Orange), Marshall McLuhan und nicht zuletzt Anne Rice (Interview with a Vampire) – sind Teil einer rückwärtsgewandten Avantgarde eines modernen Credo Quia Absurdum Est - und in diesem Sinne ebenso Zivilisationsflüchtlinge wie der arme Rimbaud. Sicherlich spielte Faszination durch die Irrationalität und Pracht der Una Sancta eine Rolle, deutlicher aber sieht man hier - den verzweifelten Griff Schiffbrüchiger nach einem intellektuellen Rettungsfloß, verbunden mit der beruhigenden Sicherheit einer Tradition; und nicht zuletzt auch: dem Geschenk einer guten Camouflage.
Greenelands Maulwürfe
Kim Philby (*1912) war ein enger Freund Graham Greenes, der das MI6 verließ, bevor ersterer als Doppelagent aufflog. Daß Greene das MI6 niemals verlassen hat und seinen alten Freund Philby als britischen Tripelagenten im KGB betreute, ist kaum verifizierbar und Gegenstand diverser Forschungsprojekte - Philbys Vater jedenfalls, St. John Philby, Abenteurer, Arabist und Machinator - war an der Inthronisation der Familie Saud als Herrscherhaus im ölreichen Wüstensand im Dienste der damaligen Öl-Companies beteiligt, deren Erben uns heute noch beschäftigen.Wir befinden uns hier also in der Parallelwelt der Geostrategischen Politik, diesmal derjenigen des sich auflösenden Raj Queen Victorias, in der, wie in allen Halbwelten, nichts so ist, wie es scheint.
Später sorgten St. Johns Sohn Kim Philby und sein Freund Maclean als MI6-Mitarbeiter jahrelang dafür, daß westliche Atomwaffenforschung oder etwa Umsturzpläne in Albanien die Moskauer Kanäle erreichten - wobei stets die Frage bleibt, ob MI6 diese Information nicht eher aus taktischen Erwägungen durch sie liefern ließ. Im Januar 1963 tauchte Philby unter, floh in die UdSSR, beantragte politisches Asyl und verstarb 1988 als hochdekorierter KGB-Mitarbeiter und Held der Sowjetunion.
Welcome to Bell Telephone Country: Be Careful With That Phone, Eugene...
Graham Bell, (*1847), ist scheinbar und chronologisch gesehen aus einem ganz anderen Topf mit Fischen. Taubstumme, Sprecherziehung, Gebärdensprache und ein philantropisches Interesse an den akustisch-sprachlich Depravierten sowie an deren eugenisch begründeter Ausrottung, die dann, nicht nur im braunen Deutschland, sondern international, für alle Andersartigen in Gesetzes- oder Verwaltungsvorschriftsform gegossen wurde und per Zwangsterilisierung oder Mord ins Werk gesetzt wurden, sind der Hintergrund für Graham Bells "Erfindung" des Telefons. Phillip Reis leistete die Vorarbeiten, Antonio Meucci und Elisha Gray waren ebenso erfinderische Vorläufer und wurden von Bell kaltblütig als Zuarbeiter ausgenutzt und als Konkurrenten mafiös ausgeschaltet. Bell Telephone wurde ein wirtschaftlicher Riese und Vorläufer heutiger Companies wie Bell Tech Labs und A, T & T.
Greeneland im Kino. Kongeniale Regisseure inszenieren Greene:
Ministerium der Angst - Fritz Lang
Die Kraft und die Herrlichkeit - John Ford
Kleines Herz in Not - Carol Reed
Das Ende einer Affäre - Edward Dmytryk
Die heilige Johanna - Greene/G. B. Shaw - Otto Preminger
Vier Pfeifen Opium/ Der stille Amerikaner - Joseph L. Mankiewicz
Unser Mann in Havanna - Carol Reed
Reisen mit meiner Tante - George Cukor
The Human Factor - Otto Preminger
Das Ende einer Affäre - Neil Jordan
|

Welcome to Greeneland
Andrea Lehmann has dreamed up, painted and built a new pictorial installation loaded with miracles. Enter: the Euphonia, an instrument reproducing the sounds of the human voice - an invention preceding the telephone - which Alexander Graham Bell then was to claim and patent, driven by greed and an inherited philantropic interest in the deaf and dumb as well as in exterminating deafness forever by eugenic measures.
We are entering Greeneland, a peculiar parallel world, where nightmares, lightmares with streaks of late 19th century technologies are interwoven with the sorrows and permutations of the declining British Empire some decades later. Flashes of subtle, playful black humour light up and our imagination drifts to places where one could imagine exquisite goldfish - or catsharks? – fitted with pretechnological gadgets, chanting secret service mantras in the crystal bowl of an elegant transsylvanian psychic.
Then we immerse ourselves into a multi-mirrored spiel which Lehmann puts into motion with savvy sophistication - involving herself, the viewers, the pictorial means, sculptural space and, not least, the reservoir of modern history and art history. Intuitively, we seem to know what made Miss Lehmann put the two Grahams - Greene and Bell; the Doves and the Deaf, as phantastic protozoa into her very own, very special goldfish bowl. Well, do we, really?
|
Anna, Magd
Anna lebte uns gegenüber bei einem Bauern und bestellte dort den Gemüsegarten hinter der großen Scheune, die dort heute noch steht. Aus unserem Küchenfenster und auf dem Schulweg sah ich sie täglich.
Klein gewachsen, trug sie Rock, Wams, Kopftuch und war fast zahnlos. Anfang der 70er Jahre muss sie schon sehr alt gewesen sein, vielleicht 85, und man sah ihr die jahrzehntelange Arbeit auf Hof und Feld an. Sie war bei den ordentlichen Dorfleuten schlecht angesehen, galt als einfältig, wenn nicht gar verrückt. Zum Pinkeln ging sie nicht ins Haus, sondern erledigte das kurz auf dem Feld oder im Gemüsegarten hockend, um dann weiterzuarbeiten – auch das half ihrem Ruf im Dorf wenig.
Eines Tages schellte sie bei uns und ich begrüßte sie. Mit der einen Hand hielt sie einen Bleistiftstummel hoch und fragte mit hoher Stimme im rheinischen Platt, ob ich diesen Bleistift habe. Mit meinen elf Jahren war ich zu überrascht und dumm, um auf ihre scheinbar absurde Frage freundlich zu antworten. Nein, diesen Bleistift habe ich nicht, sagte ich, worauf sie sich nach einer Weile wieder verabschiedete. Ich hätte ihr einen Bleistift schenken können. Ich weiß nicht, wo ihr Grab ist, ich würde dort gern Bleistift und Anspitzer hinlegen.
Euphonia
Auf dem Nachhauseweg in der Straßenbahn saß ein jüngerer Mann einem angegrauten gegenüber, der einen Gitarrenkasten dabei hatte. Wie er ihn auf das Instrument ansprach, erzählte dieser, dass er mit einer Combo samstags in einer Bar spiele und sie sich regelmäßig zum Proben träfen. Er halte seine Mitspieler immer dazu an, sich Zeit zum Stimmen zu nehmen, sie seien darin öfters nachlässig. Es sei für ihn kaum auszuhalten, wenn sie ihre Instrumente nicht sorgfältig gestimmt hätten. Die schrägen Töne, auch nur einen Hauch neben der gemeinten Note, schmerzten ihn in den Ohren. Aber wenn alles zusammenstimme und die Musik die Spieler begeistere, gebe es nichts Schöneres.
Der Jüngere meinte, er habe auch einmal Musik gemacht, auf dem Klavier, aber sein Lehrer sei ein übler Kerl gewesen und er habe es drangegeben. Manchmal singe er so für sich hin und freue sich daran. Er habe sogar daran gedacht, mit dem alten Flügelhorn seines Vaters anzufangen. Vor zwei Wochen aber habe ihn seine Freundin verlassen, wortlos und ohne erkennbaren Grund. Darüber sei er sehr traurig und schleppe sich nur mühsam durch den Alltag.
Das ist eine Stimmung, sagte der Musiker, und beide schwiegen.
Otium Vacare
for Aaron 2009
Perhaps the statement of an art that really works at the height of time, 2010, is something like this: nobody knows where it is. in places told to friends and only for a short time. it takes place, but the place is as fleeting as the artist who no longer wants to impersonate an artist. in an act of inversion, like turning a shirt sleeve inside out, the artist's role as diva will only be invisible, and the public will be limited to people he trusts. he will avoid fame, especially posthumous fame. no one knows where, when, by whom, for whom, at what price - anymore. secret art for a non-public. neg-neg-otio.
Another important thing may be the total loss and casual disregard of the concepts, plans and models presented to us of what should be considered IMPORTANT.
We have spoken of the total absence and destruction of EXPERIENCE, i.e. sensual experience of any natural and prolonged kind, 'normal' experience now being limited to a medially concocted brew of second, third and fourth hand 'experience', ready to be swallowed without the use of tongue, teeth and mind.
Sapienza, wisdom, is about knowledge, sapore, saveur, taste, in the sense of sensually tasting reality. If you can't feel the taste, you can't taste the feel of IT.
So i feel responsible for making experience possible. we can't live on surrogates. we need real touch, taste, mind, grip.
"\\\absoluement moderne\\\"
Muss Kunst eigentlich immer innovativ sein?
Ist sie dann erst gut? Oder ist Innovation die Droge eines neusüchtigen Publikums, das alles goutiert, so lange es nur neu erscheint? Muss man wirklich immer "absoluement moderne" sein, oder wird es nicht langsam wichtiger, unmodisch sich zu verhalten? Nämlich: gegen den Verschleiß der Wahrnehmungsweisen anzuleben? In einer durchvisualisierten Welt koennte es zum Beispiel interessant sein, visuelle Abstinenz zu üben. Kein Negotium sondern Otium...die Freiheit,
NICHTS
zu sehen, der visuellen Muße zu pflegen.
Switch Off Something...S.O.S. --- 2009
(Il faut être absoluement demodé...)
Paul Virilio
(Interview mit F. Rötzer, arch+ 1986)
„...Man hält mich im allgemeinen schon für einen kritischen Denker, und alle meine Bücher, auch L'espace critique. sind kritisch. Es stimmt aber, dass ich keine Lösung anzubieten habe, und ich würde sogar sagen, dass ich mir das zugute halte. Denn wir haben das Zeitalter der Meisterdenker (wie Glucksmann sagt) hinter uns gelassen und den illusionären Charakter des totalisierenden Denkens durchschaut.
Die 'schöne Totalität', wie Hegel sie nannte, gibt es nicht mehr - es sei denn in Gott, und es war illusionär unwissenschaftlich zu glauben, man könne zu so einer Totalität gelangen, wir haben keine Lösung, weil es gar keine globalen Lösungen gibt, nur episodische, fragmentarische, momentane Lösungen, und an diesen arbeiten wir. Nichts ist jemals ganzheitlich gewesen: diese Vorstellung ist das erste, was man vergessen muß. Sie war eine schreckliche Illusion in der Geschichte des philosophischen und wissenschaftlichen Denkens. Das 'Ganze' - das ist der große Bluff der Philosophiegeschichte.
...das Heil, um das es mir geht, ist nicht das Heil der Christen, das heißt das ausserweltliche Heil in der Ewigkeit. Ich glaube nicht an den Tod, und deshalb habe ich auch keine Angst (Angst im philosophischen Sinne) vor dem Unfall, auch wenn ich mich wie jeder Mensch davor fürchte, ausgelöscht zu werden.
Wenn es eine Rettung gibt, dann liegt sie in der Demut des philosophischen, des wissenschaftlichen, aber auch des politischen Denkens. Wir brauchen heute eine praktikable Demut, nicht die harmlose und fromme Demut, sondern eine radikale wissenschaftliche auch des politischen Denkens. Wir brauchen heute eine praktikable Demut, nicht die harmlose und gottgefällige Demut der Heiligen, sondern eine radikale wissenschaftliche und philosophische Demut.
Wir sind nichts.
Die Totalität wird uns immer unerreichbar bleiben. Ein Philosoph, ein Wissenschaftler, der sich zur Demut bekennt, trägt zur Rettung der Menschheit bei.
Aber diese Demut hat es immer eher bei Dichtern gegeben - ich denke an Hölderlin, an Nerval -, oft auch bei Schriftstellern - bei Kafka, bei Proust - und nur sehr selten bei Wissenschaftlern und Philosophen. Ich denke, die Zukunft der Menschheit liegt in der Demut.“ |
To Distinguish
PS:
subversion...what is being subverted?
Invidious Distinctions
The alleged subversiveness of Pop has failed in subverting anything, in the sense of subversion against an oppressive mindset. Instead, it has prepared the pathways for the complete commodification of artistic expression and the loss of an open and critical approach to art.
The anti-elitist hostility of Pop apologists against "high" art and the distinctions between "high" and "low" has brought distinctions as such and the art of distinguishing and evaluating to be seen as futile and superfluous excercises.
I think that the relevant distinction, rather than between "high" and "low", should be made between art and non-art; in so far that art, when it is truly art, is a multi-facetted, multi-layered matter and of an ireducible complexity.
The piece of art will not render itself to simplistic explanations as it has an inherent resistance against instrumental reason - as in its production, the whole human mind and soul will be engaged - nor will it serve as mere decoration - as the decorative aspects become subordinate in the process of production, even if the result is also decorative.
The agitprop piece of advertising "art" or the well-meaning piece of "bad" art is only a mock-up of art, as it lacks artistic complexity, although it will elaborately put on an "as if" manner imitating complexity.
Even the simple folk song may have what it takes to be art, but I doubt wether this is the case in some of the work of the likes of Koons, Warhol, or pother Surface-Artists.
Decorative Pieces...quite nice and colourful of course, maybe even ironic statements, self-referential. blablala...
It's the noise and the stupid distraction in this kind of work that annoys me. It's the reduction to a visual statement which bores me.
The popularist demeanour of the cultural revolutionaries is a mere camouflage of their paternalist attidude towards "the masses", the life and thoughts of which they have never even glimpsed.
What about silence.
What about enchantment.
What about leaving behind the antinomy of destruction of categories vs. the clinging to categories.
What about be ing...
|
|
|